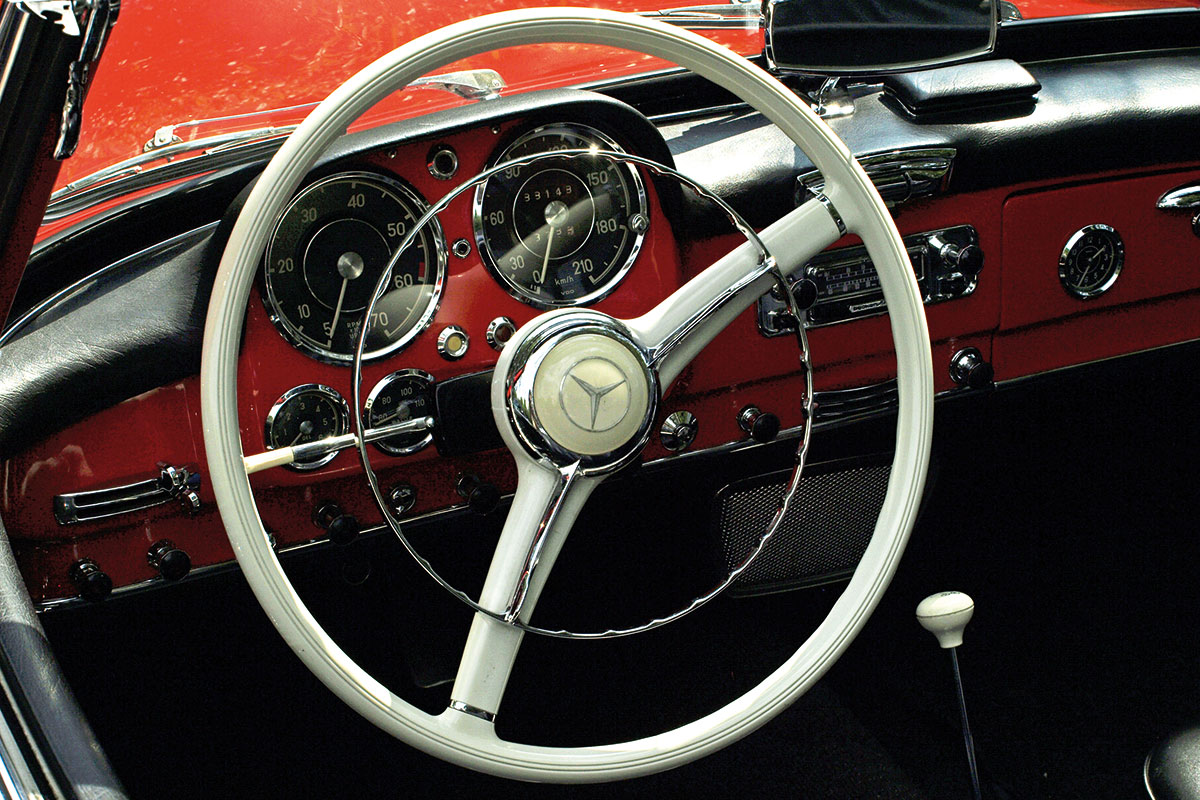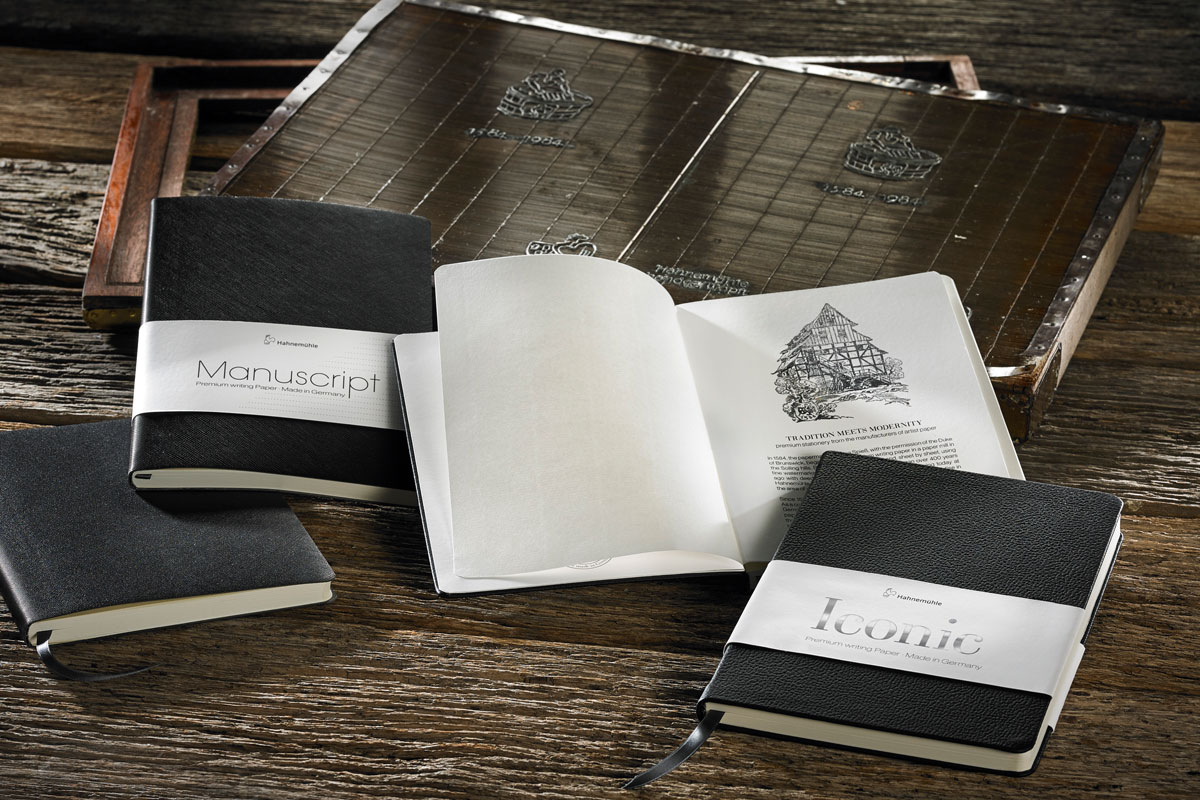Anzeige

Dr. Stefan Raab
Redakteur
Den Blick auf eine optimistische, abenteuerlustige und genussorientierte Generation gerichtet – unser Redakteur Stefan Raab leitet nach seiner Promotion in der Alternsforschung seit vielen Jahren die Redaktion unseres Magazins.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Erde dreht sich weiter und weiter und sie wird – ökologisch. Na ja, Politik und Wirtschaft in Deutschland versuchen zumindest, die über viele Jahrzehnte vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen in großem Maße zu verringern, um unseren Planeten für die nächsten Generationen noch als lebenswert zu erhalten. Dabei müssen wir Bürger:innen mitwirken, beispielsweise bei dem Austausch von Öl- und Gasheizungen zugunsten von Wärmepumpen. Wie genau das aussieht und welche Möglichkeiten sich für die Hauseigentümer bieten, erfahren Sie in unserem Spezial „Technik im Alltag“ (Seite 16).
Allerdings können wir bereits jetzt in unserem Alltag damit beginnen, auf die Umwelt stärker als bisher zu achten. Im Putzalltag wird nach wie vor viel zu viel mit Chemikalien gearbeitet. Das lässt sich leicht korrigieren durch den Gebrauch von ökologischen Putzmitteln. Autorin Susi Lotz erklärt uns, warum Wasser, Alkalisches und Saures für den Badputz vollkommen ausreichen und in hohem Maße effektiv sind (Seite 8).
Je schneller sich die Menschen von traditionellen Gewohnheiten verabschieden, desto eher können wir die Klimawende begrüßen.
Ihr
Stefan Raab, Chefredakteur,
und das gesamte aktiv im Leben-Team!
Aktuelle Veranstaltungen
Reisetipps